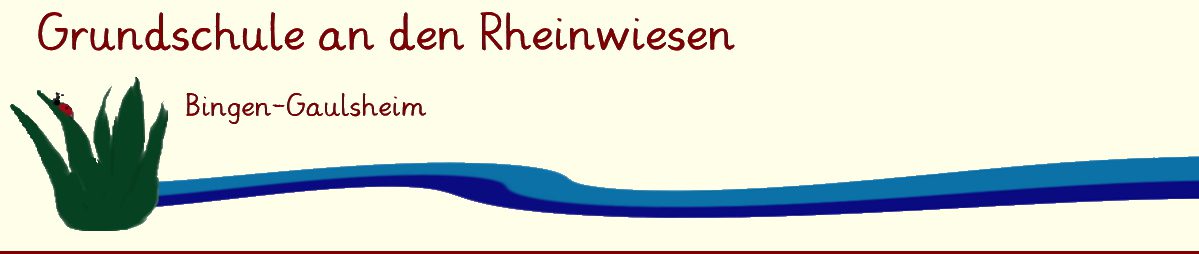Pädagogisches Grundverständnis zum Einsatz digitaler Medien
Die Lebenswelt der Lernenden ist mit allen Facetten der Ausgangspunkt von Erziehung und Unterricht. Digitalisierung muss daher Bestandteil des Bildungsgeschehens sein. Schule verfolgt jedoch andere Ziele als Wirtschaft und Industrie.
Pädagogik muss die Vor- und Nachteile der Digitalisierung in Bezug auf die kindliche Entwicklung in den Blick nehmen:
Vorteile:
- Erweiterung der technischen Möglichkeiten
- Erleichterung der weltumspannenden Kommunikation
- vorteilhafte Überwindung von Zeit und Raum (z.B. im Homeschooling)
- individuelle und integrative Förderung durch vielfältige Programme
- Motivationshilfe, wenn es etwas Besonderes bleibt und vielseitig eingesetzt wird
- ggf. Vorbereitung auf die weiterführenden Schulen
Nachteile:
- vermehrtes Auftreten von Konzentrationsstörungen,
- Verschlechterung des tiefen und komplexen Denkens
- zunehmend Kinder mit sozialen Anpassungsschwierigkeiten
- vermehrtes Auftreten von Sprachbeeinträchtigungen
- motorische Schwierigkeiten beim Schreiben
- Verlust von Mitgefühl
- schlechtere Lese- und Schreibleistungen (Lesen und Schreiben auf Papier ist nachhaltiger und lernwirksamer als auf Bildschirmen, vgl. Pablo Delgado 2018)
Digitalisierung darf niemals zum Selbstzweck eingesetzt werden, sondern sollte
- die Lernausgangslage und Entwicklungsstufe der einzelnen Kinder berücksichtigen
- herausfordernd sein
- Vertrauen aufbauen und Zutrauen ermöglichen
- Gespräche und Reflexion über den eigenen Lernprozess initiieren
- Lernen nicht als Unterhaltung „verkaufen“
- Fehler und Irrwege ermöglichen
- von einer kompetenten Lehrperson bewusst initiiert werden
Allgemeine Grundsätze des Lernens müssen auch beim digitalen Lernen stets im Vordergrund stehen:
- es braucht klare Ziele
- Orientierung an der Entwicklungsstufe der Kinder im Grundschulbereich
- eine strukturierte Lernumgebung
- Phasen des bewussten Übens
- intensive Lehrer-Schüler-Beziehung mit einer Feed-Back-Kultur
- 6-8 Wiederholungen um Inhalte vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu bringen
- geringe Gruppengröße
Digitalisierung muss demnach immer der ganzheitlichen Bildung des Menschen dienlich sein. Sinn und Zweck einer Digitalisierung ist es, den Menschen in seinem Bildungsprozess zu unterstützen. Folglich ist zu berücksichtigen, dass Einflussgrößen wie z.B. Klassengröße, Feedbackkultur, Schüler-Lehrer-Beziehung, richtige Passung von Aufgabenstellungen gleichrangige Einflussgrößen im Hinblick auf den jeweiligen Lernzuwachs darstellen.
Es ist von großer Bedeutung, beim Einsatz digitaler Lernmethoden auf eine hohe kognitive und soziale Vernetzung zu achten.
Das Medienkonzept ist stets als Entwicklungsprozess zu verstehen, das sich immer unter folgender Fragestellung ausrichten muss:
Welche neuen Medien unterstützen wann und insbesondere warum erfolgreich den Bildungsprozess und stellen somit einen Mehrwert zu konventionellen Unterrichtsmethoden dar?
Aus diesem Grund kann aktuell auch noch kein fertiges Medienkonzept unserer Schule präsentiert werden. Insbesondere im Umgang mit iPads muss zunächst eine Erprobungsphase erfolgen, deren Evaluation die in dieser Hinsicht die Grundlage des Medienkonzepts darstellen. Daraufhin werden weitere Ziele gesetzt und wiederum in Bezug auf unser pädagogisches Grundverständnis evaluiert.
Darüber hinaus wird das Medienkonzept gemäß den Richtlinien zur digitalen Bildung in der Primarstufe von 2018 immer in enger Kooperation mit den Eltern bzw. deren gewählten Vertretern abgestimmt.
In den letzten beiden Jahren haben wir mit unserer Schule am Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ teilgenommen. Im Rahmen dieses Programms stand allen Kindern unserer Schule ein iPad-Koffer mit 22 iPads als Klassensatz zur Verfügung. Auf diese Weise konnte die Digitalstrategie der Stadt Bingen unterstützt werden, ohne dass die Geräte entliehen werden mussten. Mit Auslaufen des Landesprogramms entfällt nun diese Unterstützung. Es ist daher im Digitalplan der Stadt Bingen vorgesehen, dass die Dritt- und Viertklässler ab dem nächsten Schuljahr auch an unserer Schule, wie an allen anderen Grundschulen, ein iPad kostenpflichtig leihen. Kinder, die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, sind natürlich von den Kosten befreit. Abgesehen von der Beteiligung an der Finanzierung der, auch für uns vorteilhaften, Digitalstrategie, ergeben sich aus der iPad-Entleihe noch weitere Vorteile, die sich in unserer zweijährigen Erprobungsphase nun gezeigt haben: Die Kinder können Arbeitsergebnisse auf ihrem eigenen Gerät abspeichern und bei Weiterarbeit leichter und schneller darauf zugreifen als bei der Nutzung von Klassengeräten. Hinzu kommt, dass die Zugänge zu Lernsoftware und interaktiven Übungen auf eigenen Geräten unkomplizierter sind, weil z.B. Passwörter im „eigenen“ Gerät gespeichert sind und digitale Inhalte seitens der Lehrperson besser individuell zugewiesen werden können. Trotz dieser Vorteile möchten wir aber auch unser pädagogisches Grundverständnis zum Umgang mit den iPads im Blick behalten. Dieses beinhaltet die Überzeugung, dass ein unreflektierter und ungebremster Einsatz der iPads der kindlichen Entwicklung mehr schadet als nutzt. In Absprache mit weiterführenden Schulen, sollen die Kinder in der Grundschule schwerpunktmäßig ihre Schreibmotorik/ -ausdauer trainieren und zunächst das analoge Führen von Heften und Mappen verinnerlichen.
Aus diesem Grund möchten wir, dass die iPads auch weiterhin nur punktuell im Rahmen des Unterrichtsvormittags zum Einsatz kommen und somit immer in der Schule bleiben.
Dies hat auch den Vorteil, dass die Geräte dann immer geladen und zur Hand sind.